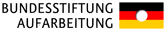Veröffentlicht am 15:07h
in
Veranstaltungshinweise
„Auswirkungen rechtsstaatswidriger Entscheidungen der DDR in der der heutigen Zeit“
Die Tagung fand statt im Menschenrechtszentrum Cottbus, Bautzener Straße 140, 03050 Cottbus (Bahnhofsnähe)
Sonnabend, 5. November 2016
Beginn: 13.00 Uhr: Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung
Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender und Prof. Dr. Schierack, MdL
13.30 Uhr
Referat (angefragt) von Dr. Hans-Jürgen Grasemann, Staatsanwalt a.D., Autor (verstorben wenige Tage zuvor)
ehem. Zentrale Erfassungsstelle Salzgitter. Zur politischen Strafjustiz als Instrument von SED und Staassicherheit
14.30 Uhr
Referat von Dr. Matthias Bath, ehem. Berliner ZERV-Staatsanwalt, Autor und ehemaliger Fluchthelfer
zu Zahlen, Gründe der mageren Ergebnisse der Strafverfolgung von DDR-Verantwortungsträgern nach 1990
und sein Buch: „1197 Tage als Fluchthelfer in der DDR-Haft“
16:00 – 18:00 Uhr
Mitgliederversammlung (nichtöffentlich) mit Vorstellung aller Mitarbeiter und 2 Verbänden, sowie Wahlprüfsteinen
danach 18:30 – 20:00 Uhr: Jugendliche aus dem MRZ-Projekt „Zeitensprünge“ präsentierten erstmals ihre
szenische Lesung „Am Scheideweg, Erinnerung an einen Unrechtsstaat“ in eigener Regie und Ausführung zum ersten Mal.
Eine fiktive Geschichte, die an das Unrecht in der DDR erinnert (auf Grundlage von Zeitzeugengesprächen, Dokumenten)
– Für das Abendessen mit Wasser (8e) bitte rechtzeitig anmelden (Formular unten im Zusatzprogramm)
Sonntag, 6. November 2016
Beginn: 9.30 Uhr: Sonderführung für Verbände durch das Menschenrechtszentrum Cottbus
u.a. mit den Zeitzeugen Siegmar Faust und Dieter Dombrowski
Im Anschluss: Aus den Verbänden, Ausblick auf das nächste UOKG-Verbändetreffen 2017
Ende: ca. 13.00 Uhr
Gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 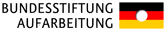
Erster Freiheitspreis Brandenburgs am 11. Okt. 2016 überreicht
Mit bewegenden Worten hat unser Bundesvorsitzender, Dieter Dombrowski, am 11. Oktober im Namen des Menschenrechtszentrum Cottbus e. V. den ersten Brandenburger Freiheitspreis des Domstifts Brandenburg entgegengenommen. Überreicht wurde der Preis von Bundesaußenminister, Frank-Walter Steinmeier | video
„Ich und mit mir viele ehemals Verfolgte des SED-Regimes sind bestürzt und beschämt über so viel Egoismus in einem der reichsten Länder dieser Welt. Wie viel Feigheit bedarf es, um Brandsätze in eine Unterkunft für Kinder und Jugendliche Ausländer zu schleudern und wie viel Mut bedarf es, wenn syrische Flüchtlinge in Leipzig einen international gesuchten Terrorristen überwältigen, fesseln und der Polizei übergeben. Ich möchte an dieser Stelle all diejenigen ermutigen, stark zu bleiben und couragiert ihren Weg von Demokratie und Humanität weiterzugehen.[…]“