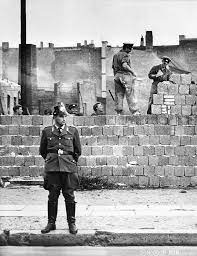22 Apr UOKG zur Vorstudie “Lieferketten der DDR-Zwangsarbeit“
Am 22. April 2024 wurden die Forschungsergebnisse der Vorstudie „Zwangsarbeit politischer Häftlinge in Strafvollzugseinrichtungen der DDR“ im Senatssaal der Humboldt-Universität vorgestellt. Das Forschungsprojekt war von der UOKG initiiert worden und wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Baberowski, Lehrstuhlinhaber für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt Universität zu Berlin realisiert. Die Autoren der Studie sind Dr. Markus Mirschel und Samuel Kunze.
Dr. Markus Mirschel führte aus, dass der Nachweis vollständiger Lieferketten von der Werkhalle des Produzenten bis hin zum Abnehmer im Westen zwar aufwändig, in einer großen Zahl von Fällen aber möglich ist. Er verdeutlichte dies am konkreten Beispiel des Exportschlagers der Damenfeinstrumpfhosen des ehemaligen VEB Strumpfkombinat Esda Thalheim, ausgehend von der Produktion in der ehemaligen Strafvollzugseinrichtung Hoheneck bis hin zum Endverkäufer Aldi Nord.
Samuel Kunze, verantwortlich für den Bereich „chronische Gesundheitsschäden durch DDR-Zwangsarbeit“, untersuchte die langfristigen Wirkungen von giftigen Chemikalien wie Chromoxid und Quecksilber, denen politische Gefangene der DDR extrem ausgesetzt waren, im Vergleich mit internationalen Studien. Mit derartigen Detailuntersuchungen können in Zukunft aufwändige Gutachter-Prozesse überflüssig werden.
Dazu Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender der UOKG:
„Das Verhalten von Politik und erfolgreichen Unternehmen, die an der Vermarktung von Produkten aus der Zwangsarbeit politischer Häftlinge der DDR Gewinne erzielt haben, ist beschämend. Die Haltung erfolgreicher Unternehmen wie Otto Group, die sich vor einer moralischen Verantwortung drücken und zusätzlich den betroffenen ehemaligen Häftlingen unlautere Motive unterstellen und ihnen drohen, ist empörend. Um unternehmerisch verantwortungsvoll zu handeln, sollte es keines Lieferkettengesetzes bedürfen, menschlicher Anstand sollte reichen. Einzig die Firma IKEA ist hier mit gutem Beispiel vorangegangen.“