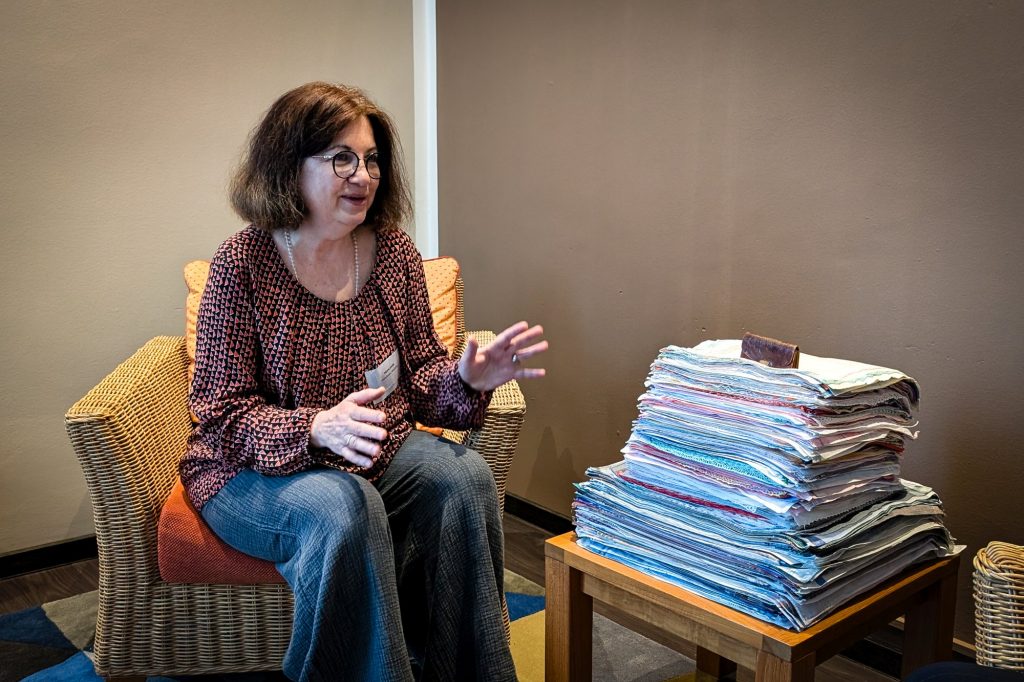07. Okt. Bericht vom Dritten Bundesfrauenkongress politisch verfolgter Frauen in der SBZ und DDR in Dessau
Vom 26. bis 28. September 2025 fand in Dessau-Roßlau der Dritte Bundeskongress politisch verfolgter Frauen in der SBZ und DDR statt. Die Wahl des Tagungsortes war bewusst getroffen: In Dessau existierte ab 1974 ein Haftarbeitslager, in dem zunächst rund 300, später bis zu 1.000 meist junge Frauen inhaftiert waren. Während ihrer Haft wurden sie zu Zwangsarbeit in verschiedenen Betrieben verpflichtet – unter anderem im VEB Fotochemisches Kombinat Wolfen und im Elektromotorenwerk VEB Elmo Dessau.
Rund 110 Gäste aus allen Ecken Deutschlands kamen zu diesem Kongress zusammen – darunter vor allem Frauen, die in der DDR aufgrund politischer Gründe inhaftiert, überwacht oder anderweitig verfolgt worden waren. Ziel der Veranstaltung war es, die Erfahrungen dieser Frauen sichtbar und öffentlich zu machen, das erlittene Unrecht weiter aufzuarbeiten und den gegenseitigen Zusammenhalt der Betroffenen zu stärken. Zugleich sollten konkrete Forderungen an Politik und Gesellschaft formuliert werden, um eine angemessene Anerkennung und Entschädigung sowie eine historische Aufklärung auf diesem Gebiet sicherzustellen.
Die Stimmen der Betroffenen
Im Mittelpunkt des Kongresses standen die persönlichen Berichte der Betroffenen. In bewegenden Beiträgen schilderten die Frauen ihre Inhaftierungen, die Verhöre durch die Staatssicherheit, psychische und physische Misshandlungen sowie den Verlust von Familie, Beruf und gesellschaftlicher Stellung. Viele erzählten auch von der sozialen Ausgrenzung, die sie nach ihrer Freilassung weiterhin erlebten.
Erstmals kamen auch Kinder von verfolgten Frauen zu Wort. Besonders eindrücklich berichteten Töchter von den Erfahrungen während der Haftzeit ihrer Mütter – von Trennungen, Angst und dem Schweigen, das oft viele Jahre über der Vergangenheit lag. Ebenso berührend war der Beitrag eines Sohnes, der als adoptiertes Kind über seine Suche nach der leiblichen Mutter sprach. Sein Bericht über den mühsamen Weg der Rehabilitierung nach dem sogenannten „Asozialen-Paragrafen“ machte deutlich, wie tief das Unrecht auch über Generationen hinweg in die Lebenswege hineinwirkte.
Diese Berichte zeigten eindrucksvoll, dass die angeblich „soziale“ DDR sicht nicht um ihre Bürgerinnen und Bürger sorgte und ihnen Hilfestellung bot,, sondern andersdenkende und -lebende Menschen systematisch kriminalisierte, ausgrenzte und ihren Lebensweg zerstörte.
Thematische Schwerpunkte
Besonders hervorgehoben wurden folgende Themen:
Der notwendige Dialog zwischen den Betroffenen innerhalb der Familien
Die Trennung von Müttern und Kindern während der Haft
Die Situation in der Strafvollzugsabteilung für Frauen in Dessau
Die systematische Diskriminierung von Frauen in den Venerologischen Stationen
Die Kriminalisierung von Frauen, die nach § 249 DDR-StGB („Asoziales Verhalten“) verurteilt wurden
Darüber hinaus fand ein Workshop zur Resilienz statt, in dem die Teilnehmenden gemeinsam darüber sprachen, wie sie trotz der traumatischen Erfahrungen Wege der Stärke und Selbstheilung finden konnten.
Resolution und Forderungen
Zum Abschluss des Kongresses verabschiedeten die Teilnehmenden eine Resolution, die unter anderem die folgenden Forderungen enthält:
Anerkennung der Kinder politisch verfolgter und inhaftierter Frauen als „Opfer des SED-Regimes“. Eine gesetzliche Regelung für diese bislang übersehene Opfergruppe ist dringend erforderlich und längst überfällig.
Anerkennung und Entschädigung der Zwangsarbeit, die politisch Inhaftierte in DDR-Betrieben leisten mussten. Zudem soll die Erforschung der Zwangsarbeit und ihrer Folgeschäden gefördert sowie die medizinische und psychologische Versorgung der Betroffenen verbessert werden.
Anerkennung und Entschädigung von Frauen, die im Rahmen unterschiedlicher Verfolgungsmaßnahmen durch die SBZ- und DDR-Behörden sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren.
Stärkung der digitalen pädagogischen Bildungsarbeit in den Gedenkstätten, um insbesondere junge Menschen an diesen außerschulischen Lernorten für die Geschichte der SED-Diktatur zu sensibilisieren.
Emotionale Momente und positive Bilanz
Der Kongress war von tiefen Emotionen geprägt – viele Beiträge bewegten die Anwesenden zu Tränen. Gleichzeitig wurde deutlich, wie wichtig diese Form des Austauschs ist: Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Viele Teilnehmerinnen reisten gestärkt ab – im Bewusstsein, nicht allein zu sein und gemeinsam für Gerechtigkeit einzutreten.
Die UOKG sowie das Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen in der SBZ/SED-Diktatur kündigten an, sich weiterhin mit Nachdruck für die Anerkennung der weiblichen Opfer politischer Verfolgung und deren Kinder einzusetzen. Auch Vertreterinnen von Gedenkstätten, Aufarbeitungsinitiativen, die anwesende SED-Opferbeauftragte und die Landesbeauftragten von Sachsen-Anhalt und Sachsen betonten die Bedeutung solcher Veranstaltungen für das kollektive Gedächtnis und die demokratische Kultur Deutschlands.
Fazit
Der Dritte Bundesfrauenkongress in Dessau war ein wichtiger Schritt zur Sichtbarmachung der Opferbiografien von Frauen und ihren Angehörigen in der DDR-Diktatur. Er trug nicht nur zur individuellen Verarbeitung des Erlebten bei, sondern setzte auch ein starkes politisches Signal für Gerechtigkeit, Erinnerung und Aufklärung.
Wir danken allen Betroffenen, Angehörigen, Gästen und helfenden Händen für ihren Beitrag zum Gelingen des Kongresses sowie dem Hotel Radisson Blu Dessau für die warmherzige und professionelle Betreuung.
Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie die Video-Mitschnitte der Vorträge und Podien des Kongresses. Später im Jahr wird es auch eine gedruckte Publikation geben. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Text: Sandra Czech
Fotos: Lucas Hütter